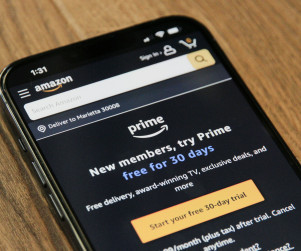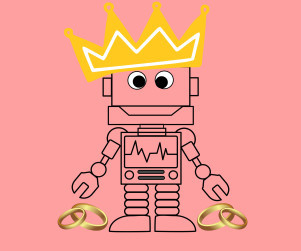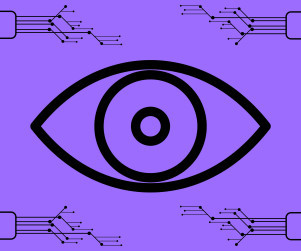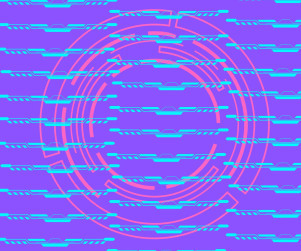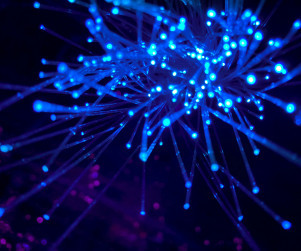Wenn der Berg zum Mensch spricht
Die Schweizer Landschaft ist stark durch die Alpen geprägt und diese bringen neben idyllischen Szenerien leider auch einige Gefahren mit sich. Bergstürze und Lawinen gehören zum Alltag in den Bergen und den umliegenden Tälern. Als Folge dessen gibt es auf Schweizer Boden bzw. auf Schweizer Bergen mehr Sensoren und Überwachungssysteme als in jedem anderen europäischen Land. Diese Technik hat schon mehrfach tödliche Tragödien verhindert und zuletzt ganz aktuell im Mai 2025 im Kanton Wallis.
Hier gibt es die ganze Sendung zum Nachhören:
Blatten - Prävention zahlt sich aus
Am 28. Mai kommt es in Blatten zum Felssturz. Schon seit Herbst des vergangenen Jahres wurden an der Nordostflanke des Kleinen Nesthorns präventiv Sensoren installiert. Das Risiko wurde anfänglich als klein eingeschätzt, da sich der Hang nur minimal bewegte. Im März 2025 verschlechterte sich die Lage zunehmend und Bewegungen nahmen deutlich zu. Expertinnen und Experten im Austausch mit lokalen Behörden konnten einige Tage vor dem Unglück die Bewegungen mithilfe von präzisen Messdaten des Überwachungssystems sehr genau mitverfolgen. Diese Entwicklungen führten schlussendlich auch dazu, dass frühzeitig die Alarmstufe nach und nach erhöht wurde. Am 23. Mai begann dann schliesslich die ersten Evakuierungsversuche des Dorfes. Am Tag des Sturzes bewegten sich mehr als 1 Million Kubikmeter Gestein und begruben so Teile von Blatten. Dank der frühzeitigen Warnungen waren am Tag des Felssturzes keine Menschen mehr im Gefahrenbereich. Es gab weder Verletzte noch Tote - grosses Glück im Unglück.
Der vernetzte Berg
Aber wie funktioniert diese Technik? In Blatten kamen drei Methoden zum Einsatz, die gemeinsam das Schutzsystem bildeten. GPS-Sensoren, Radargeräte und Kameras überwachten die Lage am Felsen und lieferten Daten in Echtzeit an die Fachleute.
Die GPS Sensoren sind direkt im Gestein hineingebohrt und installiert. Sie messen dreidimensional jede kleinste Bewegung mit einer Genauigkeit im Millimeterbereich. Radarinterferometrie hat es ermöglicht, dass grössere Flächen der Felswand beobachtet werden konnten - ähnlich zu einem Live-Foto. Zusätzlich lieferten Kameras Bildmaterial, die durch KI unterstützt ausgewertet wurden. Diese Bildanalysen zeigten visuelle Informationen, wie z.B. Rissbildungen oder Schneeablagerungen.
Zentralschweiz
Solche Systeme kommen nicht nur in bergigen Landschaften wie im Kanton Wallis oder Kanton Graubünden vor - auch hier in der Zentralschweiz werden vermehrt solche Monitoring-Programme aufgebaut. Es gibt beispielsweise auf dem Pilatus, auf dem Bürgenstock oder auch entlang der Reuss zur Hochwassersicherung. Der Klimawandel und ihre Folgen, verbunden mit stärkeren Temperaturschwankungen und extremen Niederschlägen, werden solche Technologien immer wichtiger. Für die breite Bevölkerung wird einen Teil der gesammelten Daten einsehen können, etwa über Warnapps wie Whiterisk oder über offizielle Kommunikationskanäle der Kantone. So kann es je nach Standort oder Gerät oder App vorkommen, dass Wanderinnen oder Wanderer eine SMS-Warnung bekommen.
Dilemma: Datenschutz vs. Fortschritt
Mit jeder neuen Technologie ergeben sich auch neue Herausforderungen. Diese Überwachungssysteme generieren riesige Datenmengen - von Radardaten bis Kamerabildern. Die nächste Stufe vom System ist das sogenannte "predictive monitoring", welches künftig selbstständig Daten analysiert und anhand der Sachlage Warnungen auslöst. In diesem Schritt müssen ethische und rechtliche Fragen ausnahmslos geklärt werden, um Grauzonen und Unklarheiten zu verhindern. Wichtige Fragen wie "Wer greift auf die Datenzu?", "Wie lange werden sie gespeichert?" oder "Was bedeutet das konkret für mich als Individuum" müssen beantwortet werden können - was momentan nicht ganzheitlich möglich ist. In der Schweiz sind die Regeln vergleichsweise streng. Hierzulande werden solche Monitoring Projekte oft von der öffentlichen Verwaltung in Auftrag gegeben und kontrolliert. Die Gemeinde oder Kantone tragen hierfür die Verantwortung. Aber der Markt bietet viel Potenzial für Wachstum. Immer mehr private Anbieter bieten Monitoring für Bauprojekte oder Versicherungsgesellschaften an, um Kosten oder Möglichkeit zu evaluieren. An einheitlichen und nationalen Standards wird momentan in der Verwaltung gefeilt - sie trägt den Namen PLANAT 2023 und soll letztendlich klare Vorgaben schaffen.
Wenn der Berg heutzutage spricht, dann macht er das digital und vielfältig.