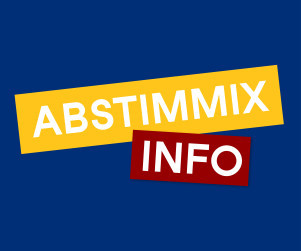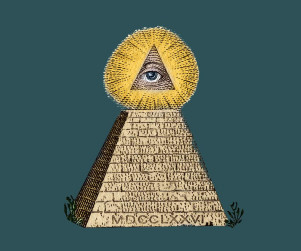Diese Woche findet das Finale des ESC 2025 in Basel statt. Eine Veranstaltung die sich bekanntermassen als unpolitisch bezeichnet und Songs mit politischen Inhalten abändern lässt oder ganz ausschliesst. Trotzdem kommt es immer wieder zu politischen Kontroversen rund um den Musikwettbewerb - auch dieses Jahr. Gleichzeitig ist der ESC auch eine wichtige Plattform für Queerness und Diversität. Wie passt das alles zusammen? Wie politisch ist der ESC tatsächlich? Und was ist überhaupt politisch und was nicht?
Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr hörst du in unserer Sendung hier:
Frieden durch Musik – die Gründungsidee des ESC
Die Idee für den Eurovision Song Contest stammt von einem Schweizer: Marcel Bezençon, damaliger Generaldirektor der SRG und Vorsitzender bei der Europäischen Rundfunkunion EBU, liess sich 1955 vom italienischen Sanremo-Festival zu einem europäischen Schlagerwettbewerb inspirieren. Zur Voraussetzung für die Teilname am Wettbewerb, der zuerst lange unter seinem französischen Namen Grand Prix Eurovision de la Chanson européenne bekannt war, wurde lediglich die Mitgliedschaft bei der EBU erklärt. Diese Europäische Rundfunkunion war nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden und hatte das Ziel den Frieden in Europa durch Zusammenarbeit und Kooperation zu stärken. Diese Idee von Frieden durch eine gesamteuropäische Integration war zur damaligen Zeit sehr populär und führte auch zur Gründung von anderen Organisationen wie zum Beispiel der EU (damals noch Europäische Gemeinschaft EG). Dieselbe Idee von Frieden durch gemeinsames Musizieren prägte die Gründung des ESC selbst und ist damit eigentlich schon hochpolitisch. Gleichzeitig wollte man durch den Gesangswettbewerb allerdings auch die damals noch neue Technologie des Fernsehen weiterverbreiten. Der erste Wettbewerb fand dann schliesslich 1956 mit sieben Teilnehmerländer in der Schweiz statt – und wurde mit Lys Assia auch prompt von einer Schweizerin gewonnen.
Vom westeuropäischen zum gesamteuropäischen Gesangswettbewerb
Der ESC wurde also als europäisches Projekt gegründet. Lange bedeutete dies in Realität allerdings nur Westeuropa, denn die Länder des Ostblocks waren keine Mitglieder der EBU und konnten deshalb nicht am Song Contest teilnehmen. Die Trennung von Ost- und Westeuropa führte zu den ersten politischen Kontroversen rund um den ESC. 1968 nahm der tschechische Schlagersänger Karel Gott – man kennt ihn als Sänger der Titelmelodie von Biene Maja – für Österreich am ESC sowie auch an der osteuropäischen ESC-Alternative Intervision teil. Er repräsentierte dabei die Spaltung Europas wie kein zweiter. Gleichzeitig wollte Österreich mit ihrer Nominierung eines tschechischen Sänger ein politisches Zeichen der Unterstützung für den Prager Frühling setzen. Auch Karel Gotts ESC-Song selbst war ein politisches Statement: Tausend Fenster handelte vom Leben in der Grossstadt, wo niemand seine Nachbarn kennt, und lässt sich sehr gut als Anspielung auf die Trennung zwischen Ost- und Westeuropa lesen. Diese würde allerdings noch lange eine Realität bleiben und so fand der Kalte Krieg auf der ESC-Bühne bald wieder an Erwähnung. 1982 gewann die deutsche Sängerin Nicole mit erst 17 Jahren den Eurovision Song Contest. Das Siegerlied Ein bisschen Frieden war ein Aufruf zum Frieden in einer Zeit, die von Aufrüstung und der ständigen Gefahr eines Krieges geprägt war. Auch hier also eine klare politische Message – ein Verbot forderte allerdings niemand.
Die politischen Kontroversen rund um den ESC
Mit dem Ziel den Frieden und Zusammenhalt in Europa zu fördern, definiert sich der ESC – ähnlich wie z. B. eine Fussball-WM – als unpolitisch. Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur sind deshalb während dem Contest untersagt, so steht es auch im Reglement. Songs oder Acts, die gegen diese Regeln verstossen, müssen angepasst werden oder werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist der Fall Georgiens im Jahr 2009. Die Gruppe Stephane & 3G wollte mit ihrem Song We Don‘t Wanna Put In gegen den russischen Einmarsch in die georgische Region Südossetien protestieren. Die Anspielung von „Put In“ auf Putin war so unmissverständlich, das die EBU auf Druck Russlands hin die Künstler*innen aufforderte, ihren Song für den Event (der in diesem Jahr in Moskau stattfand) anzupassen. Georgien zog sich daraufhin als Boykott ganz aus dem Wettbewerb zurück. 2021 beanstandete die EBU Belarus für seine Songauswahl. Der Song, der übersetzt den Namen Ich bringe dir bei trägt, lässt sich einerseits als Aufruf zur Unterdrückung der Frau verstehen und andererseits als Verhöhnung der damals aktuellen demokratischen Protestbewegung in Belarus. Im Gegensatz zu Georgien wurde hier nicht nur das Lied verboten, sondern das gesamte Land aus dem Wettbewerb ausgeschlossen.
Wie unpolitisch ist der ESC wirklich?
Wieso also setzt der ESC seine unpolitische Grundhaltung nicht überall so konsequent wie im Fall von Georgien und Belarus durch? Die Beispiele rund um politische ESC-Songs zeigen, dass es sehr schwierig ist überhaupt zu definieren, was politisch ist und was nicht. Denn könnte man wirklich ein Friedenslied wie Ein bisschen Frieden – auch wenn es eine politische Botschaft hat – vom Wettbewerb ausschliessen? Da Musik etwas ist, dass die Gesellschaft widerspiegelt, ist es sowieso fast unmöglich diese unpolitisch zu halten. Die Frage ist auch, ob man das überhaupt will. Schliesslich ist der ESC auch eine wichtige Plattform für Diversität und Queerness, was durchaus politische Implikationen haben kann. Nach seinem Sieg für die Schweiz 2024 traf sich Nemo zum Beispiel mit dem Bundesrat Beat Jans und forderte einen dritten Geschlechtseintrag. Ein Grund dafür, wieso der ESC zumindest im Schein seine unpolitischen Grundhaltung bewahren möchte, ist sicherlich dessen Kommerzialisierung. Politische Kontroversen sollen auch deshalb möglichst vermieden werden, um keine Werbeeinnahmen zu gefährden.Trotzdem ist das Politische vom ESC nicht wirklich zu trennen. So sorgt auch in diesem Jahr die Teilnahme Israels trotz des Krieges im Gazastreifen und der Auftritt von Yuval Raphael, einer Überlebenden des Hamas-Massakers, für grosse Diskussion.