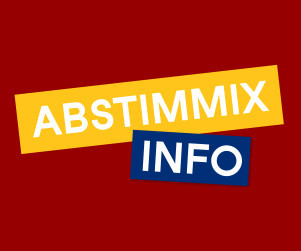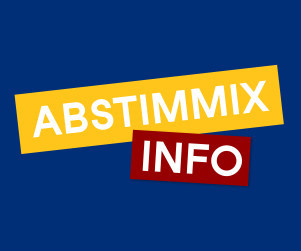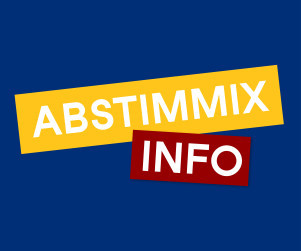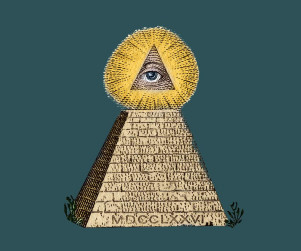Während früher Verschwörungstheorien noch etwas für Spinner, die an UFOs glaubten, waren, sind sie heute längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. In der Forschung geht man davon aus, dass in westlichen Ländern ca. 30% der Menschen für Verschwörungsglauben anfällig sind. Vor allem in Zeiten der Unsicherheit breiten sich Verschwörungstheorien schnell aus, da sie einfache Erklärungen für komplexe Zusammenhänge bieten und ein klares Feind-Freund-Denken mit sich bringen. Auch die sozialen Medien spielen bei der Verbreitung eine wichtige Rolle, da sie seriöse und unseriöse Beiträge vermischen und sich durch ihre Algorithmen Echokammern bilden, welche die eigenen Ansichten bestätigen und ein Zugehörigkeitsgefühl schaffen.
Mehr darüber, welche Gefahren Verschwörungstheorien für die Gesellschaft bergen und was man laut Susanne Schaaf von der Fach- und Beratungsstelle Infosekta dagegen unternehmen kann, hörst du hier in unserer Sendung:
Was gilt überhaupt als Verschwörungstheorie?
Eine Verschwörungstheorie wird grundsätzlich folgendermassen definiert: «eine Annahme darüber, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und damit der Bevölkerung gezielt schaden, während sie diese über ihre Ziele im Dunkeln lassen». Verschwörungstheorien schaffen also klare Feindbilder, seien das Eliten aus Wirtschaft und Politik, bestimmte Bevölkerungsgruppen oder sogar Ausserirdische. Mit den Machenschaften solcher Verschwörer werden dann Ereignisse, die von Menschen nicht direkt beeinflusst werden können, wie zum Beispiel Naturkatastrophen oder grosse Veränderungen in der internationalen Politik oder Wirtschaft, erklärt. Da diese Ereignisse häufig nur schwer fassbar sind und die Theorien oft einen realen Kern aufweisen, sind sie nur sehr schwer zu widerlegen. Für die Gesellschaft ist solches Verschwörungsdenken vor allem deshalb eine Gefahr, weil es nach einem starken Schwarz-Weiss-Muster verläuft und Verbindungen zieht, wo keine sind. So werden Ängste und Wut geschürt und Vorurteile verfestigt. In der Folge sinkt das Vertrauen in staatliche Institutionen, die Wissenschaft und die Demokratie und der Verschwörungsglaube führt dazu, dass man sich weniger mit den realen Problemen und deren möglichen Lösungen beschäftigt. Zudem besteht bei einer Überidentifizierung mit Verschwörungserzählungen die Gefahr einer Radikalisierung.
Verschwörungstheorien im politischen Alltag
Auch im politischen Alltag kann Verschwörungsdenken eine Rolle spielen. Das ist vor allem deshalb problematisch, weil Verschwörungstheorien häufig mit rassistischen, islamophoben oder antisemitischen Vorurteilen oder einer Abwertung von bestimmten Personengruppen einhergehen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Verschwörungstheorie des „White Genocide“, also von einem angeblichen Genozid an weissen Menschen. Im deutschen Sprachraum existiert eine ähnliche Konstruktion, die man allerdings eher als Theorie des „Grossen Austauschs“ kennt. Hinter dieser Verschwörungstheorie steht die Idee, dass die weisse Mehrheit in westlichen Ländern durch nicht-weisse Menschen oder Muslime ersetzt werden soll. Passieren soll dies durch Migration, aber auch durch eine gezielte Auslöschung. Diese Vorgänge vorantreiben würde eine „globale Elite“, die häufig mit dem Judentum gleichgesetzt wird. Die Theorie basiert stark auf fremdenfeindlichem Denken und greift rassistische Vorstellungen einer weissen Überlegenheit auf. Neben dem Rassismus spielt auch der Antisemitismus eine Rolle, weil eine „jüdische Weltverschwörung“ hinter dem angeblichen Bevölkerungsaustausch vermutet wird.
Diese Theorie des „Grossen Austauschs“ ist heute in der rechtsidentitären Szene weit verbreitet, findet aber auch regelmässig Eingang in den politischen Alltag. Von rechtsextremen Parteien wie der deutschen AfD wird die Verschwörungserzählung gerade in Debatten rund um das Thema Migration immer wieder aufgegriffen. Auch in den USA sorgte ein aktuelles Beispiel in letzter Zeit für Schlagzeilen: So erhielt eine Gruppe weisser Südafrikaner*innen dort den Flüchtlingsstatus – in einer Zeit, in der nicht-weisse Migrant*innen ohne Rücksicht auf ihre Rechte ausgeschafft werden. Begründet hatte Donald Trump den Entscheid mit einem angeblichen Genozid an der weissen Bevölkerung in Südafrika. Diese Behauptung eines “White Genocide“ ist nicht nur falsch, sie ist auch eine Umkehrung von Opferrollen dahingehend, wer tatsächlich von rassistischer Diskriminierung betroffen ist.
Was tun gegen Verschwörungsdenken?
Laut Susanne Schaaf von Infosekta ist die Unterstützung von Personen mit Verschwörungsglauben gerade deshalb besonders schwierig, weil diese davon überzeugt sind, die Wahrheit zu besitzen. Eine Beratung oder Therapie fokussiert sich deshalb zumeist auf Angehörige und versucht, mögliche nächste Schritte zu definieren und ein Gespräch mit der betroffenen Person zu ermöglichen. Dabei sind vor allem realistische Erwartungen und klar definierte Gesprächsziele hilfreich. Zudem sind ein sachlicher Austausch und eine nicht verurteilende, zugewandte Haltung wichtig. Ein solcher diplomatischer Austausch gestaltet sich in der Realität allerdings oft schwierig. Studien zeigen sogar, dass KI-Chatbots im Gespräch mit Verschwörungsanhänger*innen oft erfolgreicher sind als reale Personen. Dies vor allem deshalb, weil die Chatbots auf ein viel grösseres Wissen zugreifen können und in der Lage sind, Unwahrheiten mit massgeschneiderten Argumenten zu entkräften. Zudem vertreten Chatbots einen neutralen Standpunkt und nehmen eine würdigende und interessierte Haltung gegenüber ihren Gesprächspartner*innen ein. Auf diese Art gelingt es in vielen Fällen, dass Menschen ihre eigene Position hinterfragen oder sogar aufgeben.
Bei der gesellschaftlichen Bekämpfung von Verschwörungsdenken ist insbesondere Prävention notwendig, bei der das kritische Denken gestärkt und die eigene Anfälligkeit für Verschwörungsdenken hinterfragt wird. Des Weiteren ist es wichtig, auch die Ursachen von Verschwörungsglauben wie Einsamkeit oder subjektive Bedrohungsgefühle zu bekämpfen. Dies ist zum Beispiel durch Nachbarschaftsinitiativen oder gezielte Massnahmen, um das eigene Sicherheitsgefühl zu stärken, möglich.